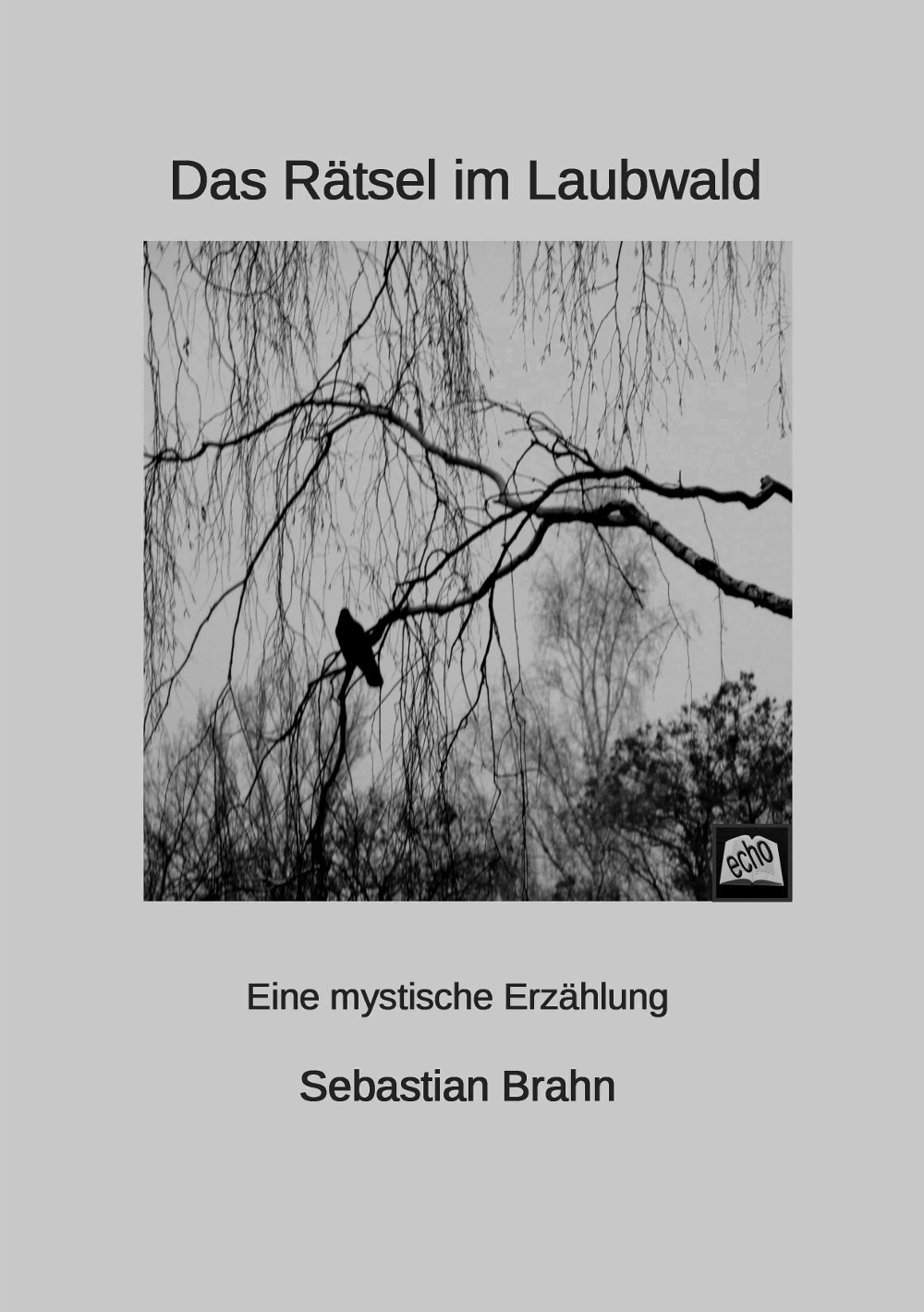Leseprobe: Wir seh'n uns wieder am Drewenz Strand
Vergeblich versuchen die Bahnbediensteten das Chaos unter Kontrolle zu bringen und die Massen abzuwehren, die sich auf den Gleisen bewegen und die Schienen blockieren. An vielen Bahnsteigen herrscht Tumult: Kinder rufen nach ihren Eltern, verzweifelt und ohne Antwort. In all dem Chaos haben sie sich verloren. Verwaist schluchzen sie ihren Jammer in eine Zeit, die sie nicht verstehen. Sie sind weggelaufen in Panik vor den Sirenen und Angriffen, vor den gellenden Schreien der Erwachsenen ringsumher. Nun finden sie nicht mehr zurück. Hast und Eile umgibt sie, Angst und Geschrei und fremde Menschen, die in Scharen unterwegs sind. Ebenso rufen Eltern nach ihren Kindern. Immer und immer wieder, bis sie irgendwann verstummen. Ratlos und elend stolpern Kinder durch die Kriegswirren. Einige sind zu Waisen geworden. Vater und Mutter sind umgekommen. Hilflos wurden sie zurückgelassen, einem ungewissen Schicksal ausgeliefert.
„Eltern zeigten Bilder von ihren Kindern, die sie nicht mehr gefunden haben“, erinnert sich Ursula. „Leute haben geschrien und Namen gerufen.“ Und sie schüttelt bestürzt den Kopf. „Immerzu haben Leute geschrien... Die Verzweiflung war überall.“
Im Bahnhof einer kleinen Ortschaft hält der Zug. Erst nach Stunden fährt er weiter. Er fährt sehr langsam. Er gleitet vorbei an endlosen Wehrmachtskolonnen. Und Zivilpersonen: Frauen, Kinder, Greise. Im dichten Schneetreiben mühen sie sich vorwärts, den Kampfhandlungen entfliehend, die im Hintergrund durch Trommelfeuer und Artilleriebeschuss den unaufhaltsamen Vorstoß russischer Truppen ankündigen. In ihrer Ausweglosigkeit versuchen manche, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Sie klammern sich an ihn und lassen doch wieder los.
Die Räder der Eisenbahn geben ein eintöniges Geräusch von sich: nntschatscha nntschatscha nntschatscha. Ursula sieht hinüber zu ihrer Mutter. Sie hat die Kleinen auf dem Schoß und die Augen geschlossen. Ihr Mund ist halb geöffnet. Das Kopftuch unter ihrer Mütze hat sich gelöst. Haare quellen seitlich hervor. Die Haut spannt sich über ihre Wangenknochen. Ein um ihren Mantelkragen geschlungenes Tuch ist verrutscht, gibt den mageren Hals frei, der bleich, mit bläulich schimmernden Adern durchzogen, aus dem mit Pelz besetzten Kragen ragt. Irritiert betrachtet Ursula die Mutter. Sie kennt sie nur als adrett und sorgsam gekleidete Frau, die keinerlei Schlamperei duldet. Das ist ihr oft auf die Nerven gefallen.
„Die Großmutter legt zwar auch Wert auf Ordentlichkeit, ist aber viel gemütlicher. ... Vielleicht weil sie dicker ist?“, erwägt sie. „Ob da ein Zusammenhang besteht?“
Als sie ihre Mutter einmal genau anschaut, hat sie fast Mitleid mit ihr.
„Wenn man bloß besser mit ihr auskommen könnte! Vielleicht...“
Jedoch machen Skepsis und Misstrauen ihre Überlegungen sogleich zunichte.
„Außerdem, wieso hat sie gerade mich an die Großeltern abgegeben?“
Irma zupft ihre Mutter am Ärmel.
„Kuck mal, da draußen liegt eine Puppe.“
Ursula sieht hinaus. Neben den Bahngleisen liegt ein in Tücher gehüllter Säugling im Schnee, die Augen halb geschlossen, der Kopf kahl und blank, wie aus Porzellan.
„Das ist keine Puppe“, stellt sie irritiert fest.
„Wirst du wohl still sein!“, mahnt die Mutter.
„Was ist es dann?“, fragt Irma besorgt. Und als sie keine Antwort bekommt: „Was ist es dann?“
„Sie liegen überall an den Gleisen“, bestätigt ein Mann, der seine Ohren mit einem Schal umwickelt hat und eine Kappe darüber stülpt. „Sie werden aus dem Zug geworfen oder weitergereicht an die vielen Leute draußen. Wenn sie Glück haben, nimmt ihnen jemand die Kinderleiche ab und vergräbt sie im Schnee.“
Leseprobe: Ihr Taufkleid war aus Fallschirmseide
Das Jahr 1948 neigt sich dem Ende zu. Zwei junge Frauen eilen die Landstraße entlang, ziehen einen Handwagen hinter sich her, auf den sie ein paar Habseligkeiten geladen haben und ein Kind, dick eingemummt. Es ist noch keine zwei Jahre alt. Rasch bewegen sie sich vorwärts, stoßen ihren Atem in einen kalten, nebligen Morgen, Aufregung und Angst unterdrückend. Sie sind auf dem Weg ins sogenannte Niemandsland, um von dort aus in den Westen zu gelangen. Ein weiter Weg liegt vor ihnen, etwa siebzig Kilometer lang. Den größten Teil der Strecke werden sie mit dem Zug fahren, der Rest muss zu Fuß bewältigt werden. Sie hoffen, am Abend in Lessien einzutreffen, ohne diesmal an der Grenze erwischt zu werden.
Im Morgengrauen sind sie aufgebrochen, weder die Kälte scheuend noch den Schnee, der auf der Landstraße festgetreten ist. Sie haben sich Kopftücher aus grober Wolle umgebunden und tragen Mäntel, die ihre alten Militärhosen darunter verbergen, die scheußlich anzusehen sind, aber warm halten und aus der Zeit ihres Arbeitsdienstes stammen. Weit ist die Kleidung geworden. Nichts passt mehr richtig, bedingt durch den Hunger über all die Jahre hinweg. Gemeinsam mühen sie sich vorwärts, ziehen den Handwagen über Eis und Schnee: Ruth und Herta, zwei Schwestern, die ungleicher kaum sein könnten. Schon von klein auf kam es immer wieder zu Konflikten, nicht unüblich bei Geschwistern, deren Altersunterschied nur gering ist. Die ausgetragenen Kämpfe sind längst vorbei. Und zumindest die Ältere von beiden, Herta, eine vom Gemüt her robuste Natur, bekümmern die gegenseitig zugefügten Gemeinheiten von früher wenig, während Ruth ihr mancherlei angetane Missetat einfach nicht vergessen kann. Und selbst, wenn sie diese vergessen wollte, bleiben doch Argwohn und eine zeitweise gefühlte Abneigung zurück, die sie stets zu unterdrücken versucht.
Herta ist nicht nur vom Gemüt her stabiler. Auch ihre Statur verrät einige Widerstandsfähigkeit, obwohl das jahrelange Darben an ihr nicht spurlos vorübergegangen ist. Wirklich dünn aber ist die Schwester. Sie wiegt kaum siebzig Pfund und neigt, im Gegensatz zu Herta, von jeher zu keinerlei Korpulenz. Ihr zart gebauter Körper ist nach der Geburt der Tochter und bedingt durch den Mangel an Nahrung, völlig abgemagert, und die schwierige Situation, in der sie sich befindet, zehrt an ihren letzten Kräften. Dennoch hat die junge Frau, Mitte Zwanzig, kaum an Attraktivität eingebüßt. Ihre feinen Gesichtszüge lassen auf ein sensibles Seelenleben schließen und auf eine tiefe Empfindsamkeit. Sie ist blass. Die dunklen Haare fallen lockig auf ihre schmalen Schultern. Wache, braune Augen, die mitunter überraschend spöttisch dreinblicken können, nehmen die Umgebung intensiv und lebhaft wahr. Herta hingegen hat ein etwas rundliches Gesicht. Von ihrer Erscheinung her wirkt sie selbstsicher. Ihre grauen Augen blicken unbefangen auf ein Gegenüber, egal um welche Persönlichkeit es sich dabei handeln mag. Sie ist von direkter Wesensart, offen und ehrlich, bis hin zur leichten Grobheit. Für gewöhnlich sagt sie rundheraus, was sie meint. Das bringt ihr nicht nur Sympathien ein.
„Für Diplomatie habe ich keine Zeit“, so ihre Begründung.
Dabei legt sie durchaus Wert auf höfliche Umgangsformen. Sie lernt gerne Leute kennen, ist aufgeschlossen und neugierig. Ruth hingegen ist eher misstrauisch. Sie ist anderen Menschen gegenüber zurückhaltend und abwartend. Ihre Aufgaben allerdings erledigt sie mit großem Ernst. Sie ist gewissenhaft und verlässlich, im Gegensatz zu ihrer Schwester, die gemeinsame Verpflichtungen meist ihr zudachte. Seit ihrer Kindheit ärgert sie sich darüber. Der Groll, der sich bei ihr angesammelt hat, bleibt jedoch von Herta gänzlich unbeachtet, wenn nicht gar unbemerkt. Doch trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere sind sie nun gemeinsam unterwegs. Sie wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind und jetzt zusammenhalten müssen.
„Hoffentlich finden wir den richtigen Übergang“, meint Ruth, mit einem leichten Vorwurf in der Stimme.
„Keine Sorge!“
„Das hast du letztes Mal auch gesagt.“
„Wir hätten ihn bestimmt gefunden, wenn wir nicht vorher geschnappt worden wären.“
„Was, wenn sie uns wieder erwischen?“
Herta beruhigt: „Es wird schon gut gehen!“
Leseprobe: Dunkel über dem Hausner Hof
Es war ein schwüler Nachmittag im Juni, als Kastner mit einer Tasse Kaffee in der Hand und an einer Zigarre ziehend, auf der Veranda seines Hauses Platz nahm. Er hatte die Hefte seiner Schüler vor sich auf dem Tisch liegen. Widerstrebend öffnete er eins nach dem anderen. Auch das von Alois, der seine Antworten mühsam, mit großer, unsicherer Kinderschrift hineingeschrieben hatte. Es ekelte ihn vor dem Stallgeruch, der von diesen Heften ausging. Unwillig stellte er die Kaffeetasse beiseite und warf die Hefte zu Boden, um sie später zu korrigieren. Er seufzte und sah zum Himmel empor. Vom Westen her näherte sich eine dichte Wolkendecke. Er lehnte sich zurück, sog an seiner Zigarre und dachte nach: Was hatte er sich einst erträumt? Und wohin hatte es ihn geführt? Er schüttelte den Kopf. War es das, was er wollte: die verschmierten Hefte schmutziger Kinder zu korrigieren? Nein, gewiss nicht! Er hatte sich seine Zukunft ganz anders vorgestellt und ehrgeizige Pläne gehabt, damals nach dem Studium. Und nun saß er hier in dieser Gegend fest und musste Schüler aus den umliegenden Dörfern unterrichten, die ohnehin an nichts Interesse hatten und sowieso dumm waren. Frustriert stieß er den Rauch seiner Zigarre in die Luft.
Indessen führte Alois behände die Heugabel, um zusammen mit Max das Heu in der Scheune unterzubringen, damit die nächste Fuhre noch herbeigeschafft werden konnte, denn es zog ein Gewitter herauf. Aus finster herannahenden Wolken hörten sie Donnergrollen. Der Hausner-Bauer arbeitete stumm und verdrossen. Er schimpfte nicht, aber seine Blicke verrieten, dass er mit der Arbeitskraft der beiden Jungen unzufrieden war. Er hätte die Frau gebraucht. Die Heugabel war zu schwer für die Buben. Sie waren zu langsam.
„Lasst es!“, schrie er gegen den Lärm der Maschinen an. „Wir müssen den Rest holen, bevor es regnet.“
Es blitzte und donnerte bereits, als der Hausner-Bauer eiligst mit ihnen auf die Wiese hinausfuhr, um einzubringen, was möglich war. Mit größter Anstrengung beluden sie den Wagen, bis der Regen auf sie herunterprasselte.
Als der Regenschauer kam, flüchtete Kastner mit seinen Heften von der Veranda aus ins Wohnzimmer. Er ließ die Balkontür offen und setzte sich auf das Sofa. Er zog einen kleinen Tisch heran und korrigierte weiter.
Leseprobe: Das Rätsel im Laubwald
Hohe Buchenbäume umgaben ihn. Ihre kahlen Äste bewegte der Wind. Feuchtes, welkes Laub lag hingestreut und bedeckte den Waldboden, der kaum berührt worden war vom Schnee des milden Winters. Der Himmel im Westen war rot von einer kalten Abendsonne. Februarabendsonne. Nebel hüllte den Laubwald ein. Nebel umhüllte auch die Leiche, die dort lag. Spaziergänger würden sie in ein paar Tagen finden und erschrecken, weil ein toter Mensch im Wald erschreckend ist. Aber ihr ganzes Leben lang werden sie davon berichten können, dass sie es waren, die jene Leiche entdeckt haben.
Hermann hat sie hierher gebracht und unters Laub gegraben, eilig, sich immer wieder umsehend und vergewissernd, dass niemand ihn beobachtete. Der Nebel stieg empor, grau kündigte sich die nahende Dämmerung an. Im abseits gelegenen Fichtengestrüpp wartete er lauernd auf die Nacht. Nichts regte sich. Schweigen lag über den Wäldern, und Nebel, der dichter werdend die hereinbrechende Dunkelheit erhellte, obgleich gerade er sie undurchdringlich werden ließ.
Frierend trat er aus seinem Versteck hervor und schaute um sich. Rasch lief er den schmalen Pfad entlang, immer bereit, im Wald zu verschwinden, falls ihm jemand, was unwahrscheinlich genug war, entgegenkommen würde. Manchmal blieb er stehen und lauschte. Unheimlich still war es, wenn er seine Schritte nicht hörte. Dann eilte er weiter, um diese Stille nicht länger ertragen zu müssen. Etwas Beängstigendes, Bedrohliches lag darin, und doch vergewisserte er sich ihrer immerzu, denn mehr als diese Stille fürchtete Hermann die Entdeckung.
Der Kies knirschte unter seinen schweren Stiefeln. Er schlug den Kragen seiner Jacke hoch und steckte die Fäuste tief in die Taschen. Es war kalt und er fror. Er dachte an die Leiche unterm Laub. Bleich war sie gewesen; bleich und noch warm.
Der Weg führte ins offene Gelände. Eine vom Nebel ergraute Finsternis ließ nichts erkennen, außer den hellen Kies unmittelbar vor seinen Füßen. Er hatte Mühe, die Konturen der mächtigen Eiche zu erspähen, die einsam auf freiem Feld stand. Schon ragten kahl und schwarz die knorrigen Äste hochauf in den Himmel, bizarr und drohend, während der Stamm und die unteren Äste im dichten Nebel eingehüllt blieben. Obwohl erwartet, zuckte er gleichsam zurück vor der Plötzlichkeit, mit der die kolossale Erscheinung andeutungsweise sichtbar wurde. Seine Schritte hallten laut durch die Nacht. Der Kies knirschte vom harten Auftritt der groben Sohlen. Schnell und entschlossen wollte er an der Eiche vorübereilen, ohne die Bank davor, die in Umrissen deutlich wurde, aus den Augen zu verlieren. Sein Blick haftete fest an jener Bank, die im hastigen Nähern gut erkennbar wurde und doch teilweise im dichten Nebel verborgen blieb. Irgendeine Gefahr schien von ihr auszugehen. Er fühlte es nur und glaubte es nicht. Er fixierte sie, mühte sich, die Trübung zu durchdringen, um die ganze Bank überblicken und sich von ihrer Harmlosigkeit überzeugen zu können.
Leseprobe: Rufus Sänger und der Abgeordnete
Sänger sieht zur Uhr, springt nervös vom Stuhl auf, läuft im Zimmer umher. Endlich klingelt es. Er macht auf. Ein eleganter freundlicher Herr in den Fünfzigern reicht ihm die Hand. Zwei Bodyguards schieben sich an ihm vorbei und betreten ungefragt die Wohnung.
Gast: Guten Tag, junger Freund, Sie haben doch nichts dagegen, dass sich meine Begleiter ein wenig umschauen. Er beugt sich lächelnd vor und flüstert halblaut: Die sind immer so in Sorge um mich. Er lacht jovial.
Sänger räuspert sich: Bitte treten Sie ein!
Gast tritt ein, sieht sich um.
Gast: Also Sie hat man ausgesucht, mich zu interviewen?
Sänger: Ähm... Ja.
Gast blickt ihm direkt in die Augen: Eine gute Wahl.
Sänger verlegen: Ich war sehr erstaunt, zumal das Los ein Versehen war.
Gast: Wie bitte?
Sänger: Nein, ich meine, ... Ach, ich bin ein wenig aufgeregt.
Gast klopft Sänger beschwichtigend auf die Schulter: Das ist verständlich. Nur immer locker bleiben! Wollen wir uns nicht setzen?
Sänger: Bitte nehmen Sie Platz! Möchten Sie was trinken?
Gast winkt ab: Ich komme gerade vom Abendessen. Grinst. Verzeihen Sie die kleine Verspätung! Er wendet sich den Bodyguards zu und gibt ihnen Zeichen zu verschwinden, nachdem sie alle Räume auf Verdächtiges hin abgesucht haben.
Gast: Also, junger Freund, Sie haben das große Los gezogen. Er lacht. Sie dürfen mich interviewen. Lacht abermals. Ein Mann aus dem Volke! Was für eine außergewöhnliche Idee! Ich bin gespannt.
Sänger setzt sich dem Gast gegenüber, sieht ihn etwas ratlos an.
Gast: Nun? Fragen Sie! Was möchten Sie wissen? Sie werden sehen, ich bin sehr aufgeschlossen. Auch wenn es ein ungewöhnliches Experiment ist, das muss ich sagen. Die Einschränkungen haben Sie ja gelesen. Ich meine... man hat Sie doch informiert, was Sie fragen dürfen und... na ja... was nicht?
Sänger: Selbstverständlich!
Gast wird streng: Nichts Privates, nichts Kompromittierendes, wenn ich bitten darf!
Sänger schüttelt verneinend den Kopf.
Gast zufrieden: Somit ist alles geklärt. Lassen Sie uns anfangen! Er greift nach einem kleinen Diktiergerät, das auf dem Tisch bereit liegt, und schiebt es Sänger zu. Schalten Sie es ein! Deshalb haben Sie es ja bekommen. Man wird es auswerten und einen Mitschnitt im Fernsehen senden. Nur einen kurzen natürlich.
Sänger ängstlich: Im Fernsehen?
Gast wirft einen Blick auf seine Armbanduhr: Ein Kameramann wird später ein paar Aufnahmen von uns machen. Sie haben doch nichts dagegen?
Sänger zieht unbehaglich die Schultern hoch, während der Gast sich bequem im Sessel zurücklehnt und sich flüchtig umschaut.
Gast: Was machen Sie beruflich?
Sänger: Ich? Ähm... Ich bin selbstständig.
Gast anerkennend: Sehr schön! …Und womit?
Sänger: Ich... gebe Klavierunterricht.
Gast: Oho! Man sieht gar keinen Flügel.
Sänger: Ich unterrichte Kinder, die ein Instrument zuhause haben, mit der Möglichkeit zu üben. Hier ginge das nicht.
Gast: Warum nicht? Dieser Raum-
Er wird unterbrochen von einem lauten Knall und zuckt zusammen. Rollen von Flaschen ist zu hören. Dann wieder Stille.
Gast: Was war das?
Sänger: Jemand hat was fallen lassen.
Gast schaut zur Nachbarwohnung, schüttelt den Kopf und wendet sich Sänger wieder zu.
Gast: Klavierlehrer also, was für ein schöner Beruf!
Sänger: Ja..., ich habe Musik studiert, dann aber was anderes gemacht. Leider ist die Firma pleite gegangen, bei der ich angestellt war. Einen entsprechenden Job habe ich nicht mehr gefunden, so fiel die Entscheidung leicht, mich selbstständig zu machen.
Gast: Bravo, das lob ich mir! Und der Verdienst?
Sänger sieht zur Seite: Es geht.
Gast: Na, na. Immerhin haben Sie ein Dach über dem Kopf.
Sänger: Immerhin.
Gast: Eigene vier Wände! Ha, als Student hatte ich nicht mal das. Zu Dritt lebten wir in einer WG. Da lernt man, sich einzuschränken. Er schwärmt. Trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Er seufzt. Diese Aufbruchsstimmung, dieses Unabhängigkeitsgefühl! Einfach herrlich. Junge Leute, die ihre Chance nicht nutzen, sind Dummköpfe.
Sänger: Heute scheint es schwierig geworden zu sein für Studenten.
Gast ärgerlich: Unsinn!
Sänger: Bedenken Sie die Wohnungsnot! Kürzlich habe ich gelesen, dass Erstsemestler eine Pappschachtel mieten würden, Hauptsache, sie stünde in einem warmen Raum, wenn es im Winter kalt wird. Das Angebot war natürlich ein Scherz, ist aber von manchen ernsthaft in Erwägung gezogen worden.
Gast fasst sich an die Stirn: Wer verbreitet denn solch einen Blödsinn? Entschuldigen Sie, man darf nicht alles glauben, was geschrieben wird! Stöhnt auf. Ich gebe ja zu, dass die Wohnungssituation im Moment nicht blendend ist. Da muss man lernen, sich anzupassen. Für uns war es damals auch nicht leicht. Wir mussten erfinderisch sein, in jeder Hinsicht. Es gab kein Internet. Die Recherchen waren aufwendig, mühevoll. Ich schrieb meine Diplomarbeit noch mit der Schreibmaschine. Stellen Sie sich das mal vor! Wieviel leichter haben es die heutigen Studenten mit ihren Computern, Smartphones, mit ihren Netzwerken und einer Fülle an Informationen! Und außerdem, was haben wir der heutigen Jugend ermöglicht, wenn man an Europa denkt! Überall dürfen sie studieren, überall leben. Diese Chance hatten wir nicht.
Sänger: Immerhin gab es den Studentenaustausch.
Gast winkt ab: Vergleichbar ist das nicht. Ich sage Ihnen, was heute durch Europa verwirklicht werden kann, ist enorm. Europa ist eine großartige Idee. Und die Jugend profitiert davon.
Von unten hört man Getrampel. Bumm, bumm, bumm, bumm.
Gast schaut eine Weile irritiert. Er scheint aus dem Redefluss gekommen zu sein. Bumm, bumm, bumm.
Sänger: Es ist die Kleine unten. Sie läuft umher und schlägt mit den Fersen auf den Boden.
Gast: Ach so, da wollen wir mal nicht so sein. Kinder sind unsere Zukunft. Dieses Land ist im Begriff zu veralten. Früher war das ganz normal, dass viele Kinder umherliefen. Es gab richtige Großfamilien. Heute hingegen-
Wieder dumpfes Getrampel, dann lautes Gequietsche. Gast horcht. Die Kleine lässt sich auf den Boden fallen. Es rumst.
Gast tadelnd: Na, na. Er sieht zur Uhr. Sollte sie nicht längst im Bett sein?
Bumm, bumm, bumm, bumm, bumm.
Gast: Das sind ja Donnerschläge. Er versucht zu lachen. Räuspert sich. Also wovon haben wir gesprochen?
Bumm, bumm, bumm, bumm.
Gast verärgert: Bitte, wie soll man sich hier konzentrieren? Ich muss schon sagen!
Wieder rumst es.
Gast: Sprechen Sie mal mit den Leuten, das geht doch nicht! Und schon gar nicht um diese Uhrzeit.
Leseprobe: Paul und das Schattengeflüster
Ein schmaler Weg schlängelt sich durch Wälder und über Lichtungen den Hügel hinauf, hinter dem schon die Sonne hinab sank. Einen roten Schein hat sie zurückgelassen, doch bald wird auch dieser
verschwunden sein und wird das Tageslicht mit sich fortgezogen haben, so dass in Kürze Dunkelheit das Land umgibt, in der die Lichter der Nacht leuchten.
Paul ist nun angekommen auf dem Hügel und sieht hinunter ins Tal. Es ruht in der sanften Beleuchtung einiger Dörfer und ist grau umschlichen vom Nebel. Er steht da und wartet, bis es dunkel ist,
denn er weiß, dass die Dunkelheit den Menschen verändert. Sie umhüllt ihn mit ihrer eigenen Realität, die geheimnisvoll und beängstigend erscheint, weil sein Auge daran gewöhnt ist, im Licht der
Sonne zu urteilen.
„In der Dunkelheit bewegen sich körperlose Schatten“, flüstert er und wendet sich rasch um. „Aber wir glauben nicht an ihre Existenz, weil die Nacht für uns zu einem verdunkelten Tag geworden
ist.“
Er geht ein paar Schritte rückwärts, den Kopf nach oben gerichtet. Er hebt die Arme und lässt sich in den Schnee fallen. Bewegungslos liegt er und horcht. Es ist still. Er betrachtet den
Himmel.
„Nacht ist es geworden.“
Ja, Nacht ist es, da die Sonne ihren mächtigen Schleier, den sie tagsüber gleichsam über unsere Köpfe warf, mit sich fortgezogen hat, um den Blick freizugeben, hinaufzusehen, zu den Sternen, zum
Mond.
„Seht sie euch an, diese glitzernden Geschenke der Nacht!“, ruft er in die Stille.
Alle Menschen, die jemals lebten, sahen empor zu ihnen, sofern sie nicht blind waren, wie so viele Menschen unserer Zeit es sind.
„Geht hinaus!“
Die Nacht reinigt manch Ekel vom Tage. Das Auge des Menschen darf ruhen, der Geist der Sonderbaren erwachen. Aber der Mensch will Licht haben und Buntes sehen, wenn er nicht schläft. Zerstreuung
nennen wir es, und sie bewirkt, dass wir auch in der Nacht lügen können.
Leseprobe: Buchners Leugnung des Himmels
Henning: Stören wir dich?
Theresa: Im Gegenteil. Schön, dass ihr gekommen seid! Ich möchte den Abend nicht allein verbringen.
Monika: Was ist eigentlich aus deinen Entwürfen geworden?
Theresa: Nichts.
Monika: Und was wirst du nun tun?
Theresa: Nichts.
Monika: Das ist gar nicht deine Art.
Theresa: Sie ist es geworden. Wenn das Tun keinen Sinn hat, gewöhnt man sich daran, nichts zu tun. Oder man bleibt ewig ein Narr.
Monika: Mit drei Kindern kannst du das schwerlich behaupten.
Theresa: Da hast du recht. Ich habe soviel zu arbeiten, dass ich nur noch müde bin. Und doch ist es kein Arbeiten im ehrgeizigen Sinn.
Henning: Ha! Wenn es danach ginge, würden die meisten Nichtstuer sein.
Theresa: Tja, Ehrgeiz ist nur dann wichtig, wenn man was erreichen will.
Buchner kommt, streift wortlos seinen Mantel ab.
Theresa überrascht: Du bist zurück? Was ist passiert?
Er lässt sich schwer auf die Couch fallen.
Theresa: Hast du keine Unterkunft bekommen?
Buchner: Ich habe nach keiner gefragt.
Theresa: Hattest du keine Ruhe wegen der Aufträge?
Buchner: Was kümmern mich die Aufträge!
Theresa, Henning und Monika sehen sich ratlos an.
Monika räumt die Schachfiguren beiseite: Wir gehen jetzt.
Buchner: Nein, bleibt doch!
Monika: Ich muss sowieso nach Hause.
Theresa: Bitte bleibt! Zu Buchner, sanft: Ausspannen kannst du auch hier.
Buchner aufbrausend: Ich will nicht ausspannen. Er springt auf, läuft im Zimmer umher. Es geht mir nicht um Erholung. Ich brauche ein anderes Leben, weil ich dieses nicht mehr ertrage.
Theresa sieht betreten zu Boden. Henning gibt Monika ein Zeichen zum Aufbruch. Monika wehrt ab.
Buchner: Kann mir einer sagen, warum er lebt? Laut: Ich will jetzt mehr als nur eine banale Antwort! ... Was tue ich hier? Fasst sich an. Mein Körper funktioniert. Ich danke dem Schicksal oder wem auch immer, dass er funktioniert, ehrlich! Klopft an seine Stirn. Auch mein Verstand ist in Ordnung. Er ist abgerichtet, dressiert auf die Belange, die mich täglich umgeben. ... Ich funktioniere Jahr um Jahr wie ein Automat. Aber wozu? Was erwartet mich am Ende? Was bleibt, wenn ich morgen sterbe?
Theresa: Eine trauernde Frau mit drei Kindern.
Buchner gelinde: Du weißt doch, was ich meine.
Theresa: Nein.
Buchner: Ich halte diese Sinnlosigkeit nicht mehr aus. Im Grunde ist alles vergeblich. Was, wenn ich einmal Rechenschaft geben muss? Was habe ich aus meinem Leben gemacht?
Theresa: Was hättest du denn machen wollen?
Buchner: Keine Ahnung. Ich spüre nur, dass es falsch läuft.
Henning: Und wie stellst du dir das Richtige vor?
Buchner: Frei. Ohne Fesseln.
Theresa: Und schickt man dich ein paar Tage in die Freiheit, kommst du am selben Abend wieder ins Gefängnis zurück.
Buchner: Weil ich nicht zu leben verstehe. Ich bewältige, was von außen auf mich zukommt. Seit Jahren mache ich nichts anderes. Einmal möchte ich nicht nur bewältigen müssen, sondern erleben dürfen.
Leseprobe: Trügerische Erbschaft
Denn in ihrem Wesen hat sich Rut kaum verändert. Und trotzdem ist sie ihr jetzt näher gekommen. Früher war sie weit entfernt. Da hatte Klara ihr eigenes Leben. Allerdings muss sie zugeben, dass sie manchmal ein wenig neidisch war, sich aber einredete, gar nicht sein zu wollen wie sie. Sie hing an ihrer Biederkeit und konnte sich nichts anderes vorstellen. Es war auch nicht besonders wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Beziehung zu Helmut ihr Sicherheit gab. Dabei hatte sie keinesfalls auf Rut herabgesehen. Im Gegenteil. Sie fühlte sich ihr unterlegen. Es schmerzte sie, dass Rut in der Firma bevorzugt behandelt wurde. Sie versuchte sich klar zu machen, dass ihre Kollegin eben eine leichtsinnige Person sei. Im Grunde wusste sie, dass es nicht stimmte, aber es half ihr, den Arbeitsalltag zu überstehen. Insgeheim hegte sie Groll gegen sie, weil sie der Liebling in der Firma war. Sie rächte sich, indem sie Rut nicht wirklich ernst nahm. Sie spielte ihre Arbeit herunter und legte ihrer Leistung nur geringe Bedeutung bei. Jetzt allerdings haben sich die Umstände geändert. Klara hat kein Leben mehr, aus dem sie ihre Daseinsberechtigung schöpft. Sie schwebt in einem unhaltbaren Zustand, dick und ratlos und ohne Zuspruch. Und obwohl Rut in einer ähnlichen Lage ist, geht sie weiterhin fest durch diese Welt. Sie tritt hörbar auf, während Klara gern unsichtbar wäre und sich nur schleichend und allen Menschen ausweichend fortzubewegen traut. Sie bewundert Rut und hält sie für stark. Eigentlich hatte sie das früher schon getan. Doch da konnte sie das Gefühl nicht zulassen, weil sie Rut als Gegnerin empfand, die sich jetzt mit ihrer Stärke überraschend neben sie gestellt hat. Und obwohl sie ihr gegenüber nach wie vor misstrauisch ist, fühlt es sich gut für sie an. Sie überlegt, ob es richtig war, Rut von den Ereignissen zu erzählen.